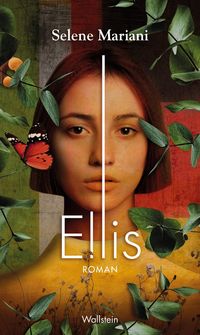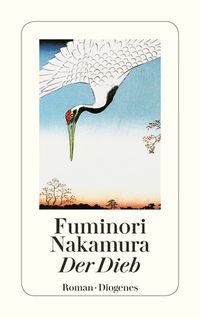
Fuminori Nakamura – Der Dieb: ist ein kleiner, schlanker Krimi. Umstandslos erzählt, stringent. Unterhaltsam. Die 210 Seiten hat man in spätestens zwei Tagen durch. Strandkorblektüre.
Das ist „internationale“ Literatur – hat nichts Japanspezifisches an sich, sieht man von den drei Wörtern Yakuza, Pachinko und Onigiri ab – von denen das bekannteste überflüssigerweise erklärt wird, die anderen jedoch nicht, doch die muss man nicht einmal verstehen, um das Buch verstehen zu können.
In der Kürze liegt die Würze?
Wenn man das Buch mit Lektorenblick liest, sieht man schon einiges, was nicht sein muss, an sprachlichen Klischees (aber gilt diese Kategorie – bei einem japanischen Autor? Ist in Japan Klischee, was es bei uns ist? Wer ist verantwortlich dafür, der Autor oder der Übersetzer?). Aber auch einige Redundanzen. Ja, ich hätte einiges gestrichen, und es hätte dadurch sicher an Stringenz noch gewonnen. Aber das hätte das Buch nicht verbessert – es beschränkt sich sowieso schon gar zu sehr auf das Gerippe. Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Buch nicht zwangsläufig poetisch wird, wenn man Aristoteles´ Poesie folgt und alles streicht, was nicht handlungsrelevant ist.
Aufbau
Eigentlich gibt der Plot einen „Roman“ nicht her. Die Erzählervorstellung (der titelgebende Dieb selbst) nimmt fast das erste Drittel ein (keine Kunst bei einem so schmalen Band), dann erst setzt die Romanhandlung ein, und zwar recht willkürlich: Der Dieb wird von einem früheren Kollegen, der ihm aufgelauert hat, angesprochen. Die Handlung entwickelt sich erst in Rückblenden und dann auch in der Erzählgegenwart – das Cover sagt das so: „Seine Vergangenheit versucht Nakamura zu vergessen, doch eines Tages holt sie ihn ein.“ Nun ja, diesen Vergessensversuch haben die Werbetexter eher erfunden; hier wird eine Denkfigur auf einen Roman angewandt, in dem etwas nicht präsent ist, dann aber plötzlich erinnert wird. Die Handlung besteht darin, dass der Dieb drei Aufgaben lösen muss (natürlich: drei), und es ist durchaus interessant, wie er es tut. Was auch heißt: Wie es erzählt wird. Erst wird die Schwierigkeit aufgebaut, dann wird gezeigt, warum er es nicht schaffen kann, und dann folgt, wie er es doch geschafft hat, und zwar mit einer Methode, die vorher nicht angedeutet war. Ein wenig schal ist, dass man bei dieser Erzählmethode außen vor gelassen wird. Man hat keine Chance mitzudenken – sich zu überlegen, wie er es doch schaffen kann – man stolpert dann schon rein und kann nur noch denken, „pfiffig“. Den Leser am Buch zu beteiligen ist etwas anderes.
Unterhaltung
Diese drei Diebstähle machen den Hauptteil des Buches aus. Ich möchte das nicht unerwähnt lassen: Man liest es mit Spannung, es macht Spaß. Auch, was ich oben über die Klischees gesagt habe, tut dem gar keinen Abbruch. Wenn man nicht mehr will als eine kurze Unterhaltung z. B. für eine Bahnfahrt –: taugt dafür. Macht Spaß, unterhält.
Deus ex machina
Das Ende jedoch war für mich enttäuschend. Dass der große Yakuza-Boss Kizaki den Dieb erschießt, erscheint reichlich unmotiviert, nachdem er doch gerade seine herausragende Qualifikation bewiesen hat, nachdem der Boss selbst seinen Wert erkannt hat. Das lässt sich nur durch diese vorangestellte Geschichte erklären (die natürlich Kizaki erzählt), in der von der gottgleichen Dominanz über das Leben eines anderen filosofiert wird (pardon, ich kann das hier nicht mit ph schreiben), der dann willkürlich ermordet wird. Die Willkür. Und laut Kizaki soll das dann – und die Erkenntnis davon – ein erfülltes Leben, ein glücklicher Tod sein. Hm. Mich überzeugt das nicht. Und dann, deus-ex-machina-like, nachdem Kizaki abmarschiert ist, sieht der tödlich verletzte Dieb doch noch eine Möglichkeit, gerettet zu werden und ergreift sie. Ende. Fortsetzung folgt? Möglich wär´s.
Damit ist zwar die Erzählperspektive (Ich, im Nachhinein) gerettet. Aber es ist trotzdem reichlich platt. Ebenso platt wie das Leitmotiv des Turmes, ein mahnender Zeigefinger, den er (natürlich) im Sterben unmittelbar vor Augen hat, sodass es wie eine Vorhersehung war … ach je.
Was habe ich da eben gelesen?
In Japan, teilt uns der Verlag mit, ist Nakamura ein Literaturstar. Unterhaltsam ist Der Dieb in jedem Fall. Aber nach der Lektüre hat man trotzdem das Gefühl: „Womit habe ich da eben meine Zeit verbracht?“ Es ist eben Zeitvertreib. Nichts weiter. Will sicher auch nicht mehr sein (das Lob von Kenzaburo Oe hin oder her), und wer auch nicht mehr will, dem sei das Buch empfohlen. Für mich war es einfach zu einfach, zu vorhersehbar. Was wiederum interessant war: Obwohl überdeutlich nach einem Schema gestrickt, hat dieses Schema doch funktioniert.
Mein Fazit
Das ist es, was ich als Autor für mich aus dem Buch gezogen habe: So ein Schema funktioniert selbst dann noch, wenn es überoffensichtlich es angewandt wird. Und: Kürzen bis aufs Gerippe runter ergibt nicht automatisch Poesie/„Literatur“.
„Vom Wall Street Journal wurde (Der Dieb) unter die zehn besten Romane des Jahres 2012 gewählt.“ => Der Wall Street Journal hat keine literaturkritische Relevanz. Dasselbe gilt auch für die Financial Times, deren absurdes Lob ich hier nicht wiederholen will. Was sagt es, dass das Buch ausgerechnet von zwei Periodika mit Wirtschaftsschwerpunkt hochgejubelt wird?